Darum arbeiten Arbeitslose nicht
Warum arbeiten gehen, wenn man fürs Nichtstun fast genauso gut bezahlt wird? Die Liste der vermeintlichen Argumente, warum Arbeitslose nicht arbeiten, ist lang. Ein Blick auf die Fakten beweist jedoch: Weder Unwillen noch ein zu hohes Arbeitslosengeld sind die Gründe












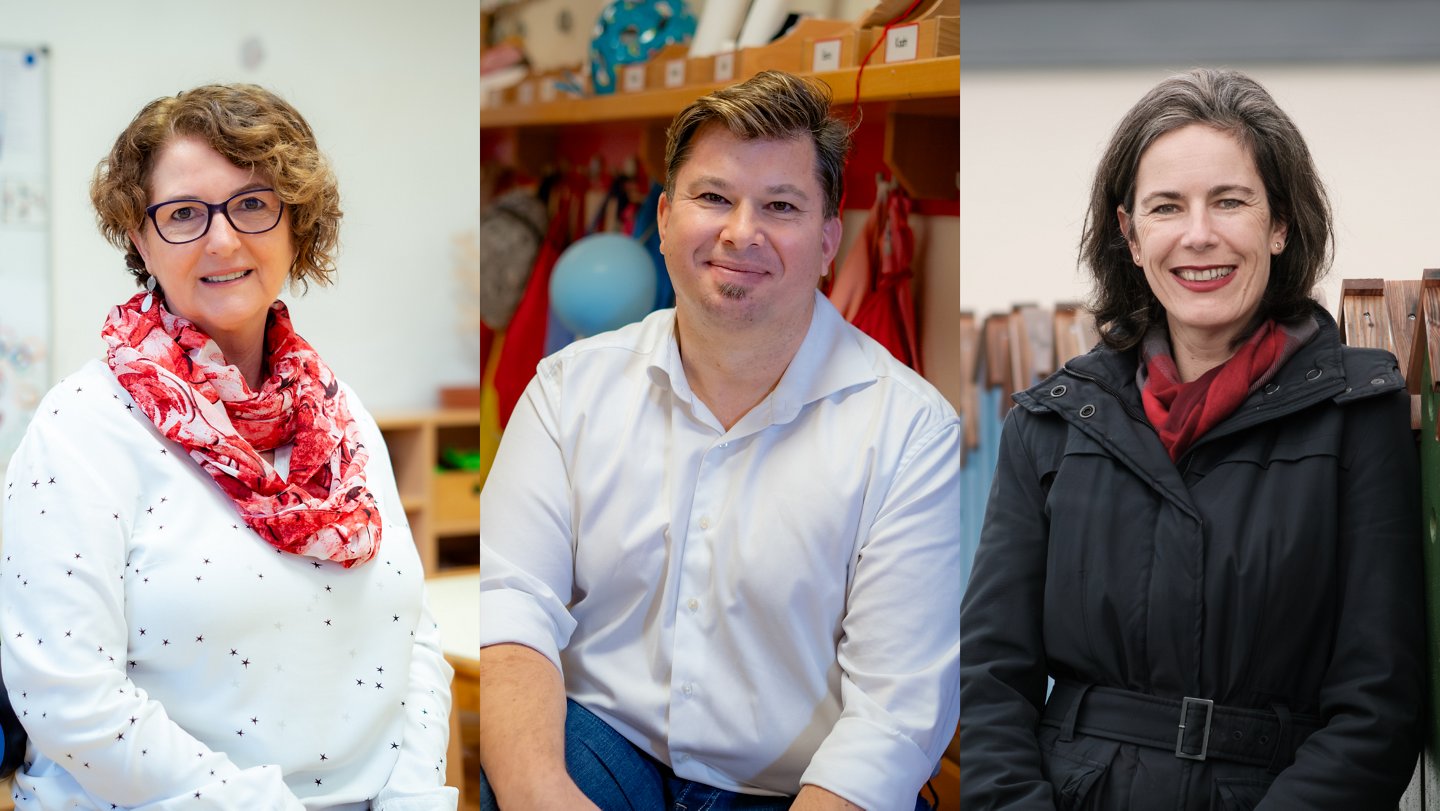

Olga_AdobeStock_491011863_web?qlt=85&ts=1710247234568&dpr=off)



